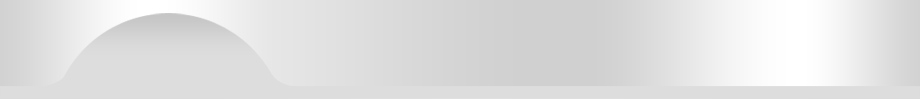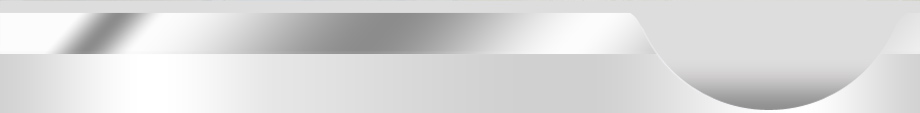

 |
 |
 |

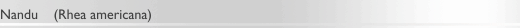
Der Nandu ist mit einer Scheitelhöhe von 130 bis 150 Zentimetern, einer Rückenhöhe von ungefähr 100 Zentimetern und einem Gewicht von 20 bis 25 Kilogramm zwar deutlich kleiner als sein afrikanischer Vetter, der Strauss (bei dem die männlichen Tiere gewöhnlich etwa 250 Zentimeter hoch und ungefähr 110 Kilogramm schwer sind). Er übertrifft aber seinerseits klar sowohl den Darwin-Nandu als auch den Anden-Kondor (Vultur gryphus) und ist damit unbestritten der grösste Vogel der Neuen Welt. Wobei diese «Ehre» vor allem den Männchen zukommt, denn wie beim Strauss sind auch beim Nandu die Hähne im Durchschnitt etwas grösser als die Hennen.
Das Federkleid des Nandus ist sehr «flauschig», da die beiderseits des Federschafts abzweigenden Federästchen nicht durch Häkchen miteinander verbunden sind und somit keine festen Fahnen bilden, wie es bei den flugfähigen Vögeln der Fall ist. Für einen fluguntüchtigen Vogel sind die Flügel aber überraschend lang und erreichen eine Spannweite von bis zu 250 Zentimetern. Gewöhnlich trägt sie der Nandu wie einen Umhang über den Rumpf gefaltet. Während der Balz stellt er sie aber bei seinen komplexen «Tanzdarbietungen» imposant zur Schau. Und bei Gefahr setzt er sie ein, um erstaunlich kurze Haken zu schlagen: Dazu hebt er in vollem Lauf den einen Flügel und senkt den anderen, wodurch eine ähnliche Steuerwirkung entsteht wie die der Querruder eines Flugzeugs. Der grosse Vogel kann auf diese Weise plötzliche und extreme Richtungswechsel vornehmen.
In den Pampas zu Hause
Die Heimat des Nandus sind zur Hauptsache die «Pampas», das heisst die offenen, weiten Grasländer Südamerikas - vom nordöstlichen Brasilien südwärts bis ins zentrale Argentinien, und von Meereshöhe bis in Höhen von 2000 Metern ü.M. Aber auch in Waldrandzonen und buschdurchsetzten Regionen trifft man ihn an. Hingegen meidet er dichte Wälder sowie das Gebirge. Hierin unterscheidet er sich deutlich von seinem kleineren Bruder, dem Darwin-Nandu: Als ein Bewohner kälterer Gebiete kommt dieser nicht nur in den Pampas-Grasländern Patagoniens vor (wo der Nandu fehlt), sondern auch in den Puna-Hochsteppen der peruanischen und chilenischen Anden in Höhen von teilweise bis zu 4000 Meter ü.M.
Hinsichtlich seiner Ernährung erweist sich der Nandu als echter «Generalist»: Gräser und Kräuter aller Art, welche zwischen den hohen Pampasgräsern reichlich wachsen, bilden seine bevorzugte Nahrung. Er verschmäht aber auch Früchte und Samen nicht. Und er verspeist ferner gern Heuschrecken und andere grosse Insekten sowie Frösche, Eidechsen und Nagetiere, sofern er ihrer habhaft werden kann.
Bei der Nahrungssuche schreitet der grosse Vogel gemächlich durch sein Wohngebiet und pickt während des Gehens ständig mit seinem Schnabel nach irgendwelchen Futterdingen. Kleintiere packt er jeweils mit einem blitzschnellen Vorwärtsruck seines langen, gebogenen Halses.
Hähne sind Alleinerzieher
Lockere, mehr oder weniger sesshafte Trupps von gewöhnlich 10 bis 30, manchmal auch bis zu 100 Vögeln bilden die Nandus ausserhalb der Fortpflanzungszeit. Während der Brutzeit, welche in die Monate September bis Dezember fällt, splittern sich diese Trupps dann in Kleingruppen auf, die gewöhnlich aus einem Hahn und fünf bis zehn Hennen bestehen. Denn sobald die Brutsaison beginnt, werden die Männchen territorial und vertreiben alle Nebenbuhler aus ihrem Revier, während sie gleichzeitig mittels vielfältiger Balzrituale versuchen, einen möglichst grossen «Harem» von Weibchen um sich zu scharen. Verwegene Laufspiele mit gesträubtem Gefieder, elegantes Hin- und Herpendeln des Halses und vieles mehr ist dann zu sehen. Zu dieser Zeit lassen die balzenden Männchen auch häufig den tiefen, weittragenden Ruf «nan-du» verlauten, dem die Vögel ihren Namen verdanken.
In der Folge zeigt sich, dass die Nandumännchen «aufopfernde» Väter sind, denn ihnen ganz allein obliegt nicht nur der Nestbau, sondern auch das Ausbrüten der Eier und die Aufzucht der Jungen - eine in der Tierwelt nicht allzu häufige Sache.
Nach Abschluss der Balzrituale und nach erfolgter Paarung mit seinen «Haremsdamen» legt der Hahn an einer vor unerwünschten Blicken gut geschützten Stelle sein Nest an: Es handelt sich um eine flache Mulde im Erdboden mit einem Durchmesser von etwa einem Meter, die er mit trockenem Pflanzenmaterial auslegt und umrandet. Dann führt er die legebereiten Hennen zum Nest, wo nun jede von ihnen während eines Zeitraums von ein bis zwei Wochen ungefähr jeden zweiten Tag ein Ei legt. Befinden sich vier oder fünf Eier im Nest, so beginnt der Hahn mit der Brut. Die jeweils zum Eierlegen bereiten Weibchen kommen weiterhin zum Nest und legen ihr Ei kurzerhand neben dem Männchen ab, das es dann sofort sorgfältig mit dem Schnabel in sein Nest rollt. So sammeln sich gewöhnlich um die 20 Eier an, doch sind auch schon Grossgelege mit bis zu 80 Eiern entdeckt worden. Selbstverständlich kann der Hahn beim Brüten nicht so viele Eier bedecken und somit nicht alle ausbrüten. Deshalb bleibt stets ein gewisser Prozentsatz übrig, in dem sich keine Küken entwickeln. Warum sich die Nandus diesen «Überfluss» an Eiern leisten, ist nicht geklärt.
Wenn die Küken nach einer Brutzeit von gut fünf Wochen aus ihren dickschaligen Eiern schlüpfen, so unterstützt sie das pflichtbewusste Männchen tatkräftig dabei. Die Jungvögel tragen anfänglich ein hellbraunes Federkleid mit dunklen Längsstreifen auf dem Rücken, das sie in ihrem Lebenraum ausgezeichnet tarnt. Davon abgesehen sind sie kleine Ebenbilder ihrer Eltern, können sogleich auf ihren Beinchen umherrennen und picken von Anfang an selbständig nach Nahrung. Während der ersten Lebenstage ernähren sich die Kleinen überwiegend von Insekten, und der Hahn führt sie zu entsprechenden Nahrungsquellen. Doch allmählich folgen sie dem Beispiel ihres Vaters und nehmen ebenfalls Pflanzennahrung zu sich.
Das Nandumännchen verteidigt seinen Nachwuchs entschieden gegen alle Eindringlinge und hält selbst die eigenen Weibchen auf Distanz. Nanduhähne mit Jungen haben im Übereifer auch schon berittene Viehhirten angegriffen, ja in einem Fall sogar ein Kleinflugzeug.
Zuverlässige Wächter
Nach einem halben Jahr haben die jungen Nandus die Grösse ihrer Eltern erreicht, und wenn der südliche Sommer zu Ende geht, sammeln sich die Altvögel mitsamt den Jungen wieder zu grösseren Trupps. Dann vermischen sie sich auch oft mit Rudeln von Pampashirschen (Ozotoceros bezoarticus), wobei in erster Linie die Hirsche von dieser Vergesellschaftung zu profitieren scheinen: Das überaus scharfe Sehvermögen der Nandus, gekoppelt mit ihrem hervorragenden Gehör und der Möglichkeit, dank ihres langen Halses und der langen Beine das Pampasgras zu überblicken, machen die Laufvögel nämlich ungewollt zu äusserst zuverlässigen «Wächtern» auch für andere Pampasbewohner. Schon auf grosse Entfernung nehmen sie jeden Feind sofort wahr.
Bei Gefahr vermögen sich die Nandu dank ihrer kräftigen Beine mit den drei grossen, weit spreizbaren Zehen mühelos in kurzer Zeit in Sicherheit zu bringen. Sie «fliegen» dann förmlich mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern in weichen, «hüpfenden» Zwei-Meter-Sätzen durch die Graslandschaft.